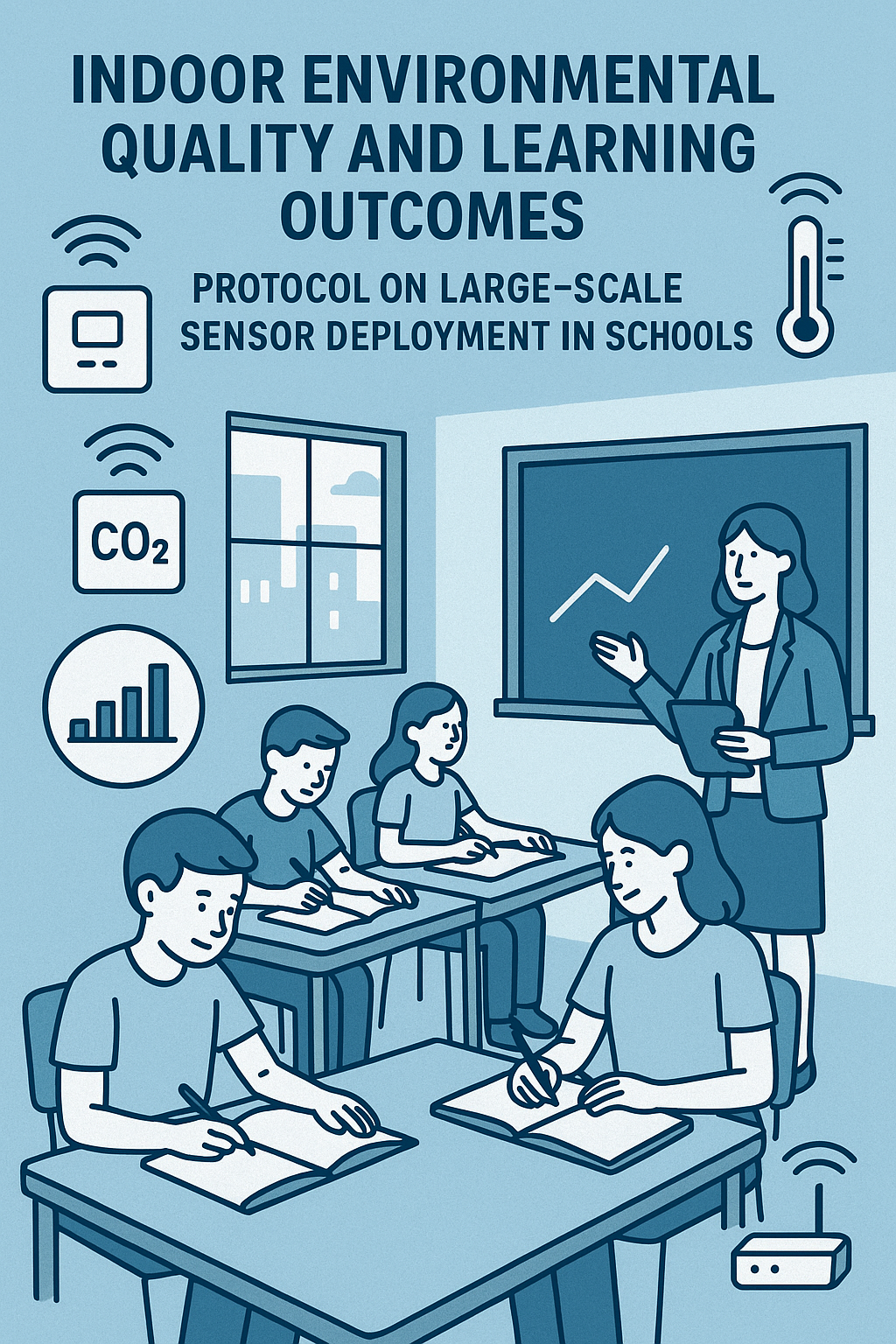
Indoor environmental quality and learning outcomes: protocol on largescale sensor deployment in schools
Was macht das Raumklima mit der Lernleistung?
Kinder verbringen einen großen Teil ihrer Kindheit in geschlossenen Räumen – oft über 7.000 Stunden im Klassenzimmer. Doch welchen Einfluss haben Luftqualität, Temperatur und Lärm dort eigentlich auf ihre Lernleistungen?
Ein Forschungsteam der Universität Maastricht hat dazu eine groß angelegte Langzeitstudie gestartet. Über einen Zeitraum von fünf Jahren werden mehr als 10.000 Schüler*innen in 280 Klassenzimmern begleitet. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen dem Raumklima in Schulen und der kognitiven Entwicklung sowie Gesundheit der Kinder zu untersuchen.
Was wird gemessen?
In jedem Klassenzimmer werden Sensoren installiert, die jede Minute folgende Umweltfaktoren erfassen:
- CO₂-Konzentration
- Feinstaub (grobe Partikel)
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Lichtintensität
- Geräuschpegel
Die Sensoren sind fest an einer Höhe von 1,50 m angebracht – etwa in Atemhöhe der Kinder.
Auch außerhalb der Schule wird die Luftqualität kontinuierlich erfasst: Feinstaubbelastung (PM10, PM2.5, PM1), Temperatur und Luftverschmutzung.
Welche weiteren Daten werden erhoben?
Zusätzlich werden individuelle Daten der Kinder gesammelt, u. a.:
- Kognitive Leistungen (z. B. Testergebnisse wie Cito oder schulische Verlaufssysteme)
- Gesundheit (z. B. Krankmeldungen, Medikamenteneinnahme, Krankenhausaufenthalte)
- Sozioökonomischer Hintergrund (z. B. Einkommen und Bildungsstand der Eltern)
Damit können die Forscher genau analysieren, wie Unterschiede im Raumklima das Lernen und das Wohlbefinden einzelner Kinder beeinflussen.
Was macht diese Studie besonders?
Bisherige Studien zum Raumklima in Schulen hatten viele Einschränkungen:
- Kleine Stichproben (meist unter 2.500 Kinder)
- Daten auf Klassen- statt auf Individualebene
- Kurze Messzeiträume (oft nur ein paar Tage)
Diese neue Studie ist deutlich umfangreicher, misst über Jahre hinweg und berücksichtigt sowohl Umweltfaktoren als auch individuelle und soziale Merkmale.
Ein weiterer Vorteil: Das Studiendesign erlaubt eine Unterscheidung zwischen:
- Strukturellem Effekt (durchschnittliches Raumklima über ein ganzes Jahr)
- Momentanem Effekt (z. B. Luftqualität am Tag einer Prüfung)
Was erwarten die Forschenden?
Frühere Studien deuten darauf hin, dass schlechte Belüftung und hohe CO₂-Werte zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und geringerer Leistungsfähigkeit führen können. Auch Wärme und Lärm beeinträchtigen das Konzentrationsvermögen.
Für Kinder im Grundschulalter fehlt jedoch bislang belastbares Datenmaterial – diese Studie soll diese Lücke schließen.
Die Ergebnisse sollen Politik, Kommunen und Schulen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen – etwa bei Lüftungsstandards, Schulrenovierungen oder der Gestaltung von Lernumgebungen.
Zusammenfassung
In einer groß angelegten niederländischen Langzeitstudie werden 10.000 Grundschulkinder über fünf Jahre begleitet. Gleichzeitig wird kontinuierlich das Raumklima ihrer Klassenzimmer erfasst.
Die Studie verknüpft diese Umweltdaten mit Informationen zu Lernleistung, Gesundheit und sozialem Hintergrund.
Ziel: Herausfinden, inwieweit Luftqualität, Temperatur und Lärm das Lernen und Wohlbefinden von Kindern beeinflussen.
Dank ihrer einzigartigen Methodik kann die Studie wertvolle Erkenntnisse für Bildung, Gesundheit und Schulbau liefern.
Quelle:
Palacios Temprano J, Eichholtz P, Willeboordse M, Kok N.
Indoor environmental quality and learning outcomes: protocol on large-scale sensor deployment in schools.
BMJ Open 2020;10:e031233.